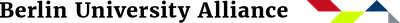Zusammenfassung, Diskussion und Empfehlungen
Die Auswertungen des Berlin Science Survey zielten auf die Frage, was gute Rahmenbedingungen für die Wissenschaft sind. Der Fokus lag dabei vor allem auf dem Zusammenhang von sich unter gegebenen Rahmenbedingungen entwickelnden Forschungskulturen und Forschungsqualität. Dazu wurden Aussagen von 2.767 Wissenschaftler:innen aus dem Berliner Forschungsraum ausgewertet, darunter 2.032 Wissenschaftler:innen der vier BUA-Einrichtungen sowie weitere 735 von außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Berlin. Ergänzend wurden 2.471 Wissenschaftler:innen von Exzellenzuniversitäten außerhalb Berlins befragt. Dieses Vergleichssample dient der Überprüfung, ob einzelne Ergebnisse nur für den Berliner Raum oder auch darüber hinaus Gültigkeit haben.
Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen für Wissenschaft werden sowohl auf der nationalen Ebene, als auch auf der lokalen Ebene der Einrichtungen, als nicht sonderlich gut eingeschätzt. Hier gibt es einige Verbesserungsmöglichkeiten. Drei Viertel der Befragten kritisieren das Finanzierungssystem und vier Fünftel die Karrierestrukturen im Wissenschaftssystem. Auf lokaler Ebene, der BUA-Einrichtungen werden im Besonderen die Verwaltungsprozesse von insgesamt 83 % als „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ beurteilt. Daher wird hier bei den Verwaltungsprozessen auch der größte Unterstützungsbedarf durch die Einrichtungen gesehen (71 %). Der zweitgrößte Unterstützungsbedarf wird im Zusammenhang mit der Drittmittelakquise gesehen (50 %).
Der Vergleich zwischen den Einrichtungen der BUA und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Berlin zeigt zudem, dass die Probleme mit der Verwaltung an den Universitäten deutlich größer sind, während die außeruniversitären Einrichtungen – sicherlich auch bedingt durch mehr Grundmittel – hier deutlich weniger Schwierigkeiten haben.
Abgesehen von den Schwierigkeiten in den Verwaltungsprozessen wird das Forschungsumfeld des Berliner Forschungsraums hinsichtlich mehrerer auch für die BUA relevanter Zieldimensionen als durchaus positiv bewertet. Innovativität wird von 84,2 %, Kooperationsfähigkeit von 82,3 % und Internationalität von 88,4 % „gut“ bis „sehr gut“ bewertet. Die Forschungsqualität sogar von 91,4 %. Diese Werte haben sich gegenüber 2022 sogar noch verbessert. Auch die Einschätzungen zur „Umsetzung von Open Science“ haben sich gegenüber 2022 deutlich verbessert. 67,4 % der Wissenschaftler:innen sehen den Berliner Forschungsraum diesbezüglich gut aufgestellt, gegenüber 59,1 % der Befragten vor zwei Jahren.
Gleichzeitig kann sich die BUA in ihrem Wirken, den Berliner Forschungsraum voranzubringen, durchaus gestärkt sehen. Die BUA ist gegenüber 2022 bekannter geworden und mit 51% sind inzwischen noch mehr Wissenschaftler:innen aktiv oder passiv in die Aktivitäten der BUA involviert. Das spiegelt sich auch in einem leicht verbesserten Image der BUA: Etwas mehr Wissenschaftler:innen als noch 2022 glauben an eine Gestaltungskraft der BUA, den Berliner Forschungsraum innovativer (52,4 %) und internationaler (60,2 %) zu machen.
Arbeitsmotivation
Die Forschungs- und Arbeitskulturen in den Wissenschaften sind durch eine sehr hohe intrinsische Motivation gekennzeichnet. Das gilt im Besonderen für Professor:innen. Hier geben 91,8 % an, dass ihnen die Arbeit Freude macht und 88,8 % sagen, für sie sei Wissenschaft nicht nur ein Beruf, sondern Berufung. Dieses hohe Maß an Motivation (und Berufsethos) birgt Gefahren der Selbstausbeutung, bzw. Selbstaufopferung.
Arbeitsbelastung
Die Wissenschaftler:innen sind stark belastet durch die vielen Aufgaben und die hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden oder die sie auch an sich selbst stellen. Das zeigt sich zum einen in hohen Wochenarbeitsstunden und Überstunden. So arbeiten Professor:innen durchschnittlich 51,2 Stunden pro Woche. Die gegenüber der vertraglichen Arbeitszeit geleistete wöchentliche Mehrarbeit beträgt bei Postdocs 6,1 Stunden und bei den Prädocs 7,9 Stunden. Bei den Prädocs treten Überstunden vor allem in den Fachbereichen auf, in denen häufiger Teilzeitverträge vergeben werden. Da sich die reale wöchentliche Arbeitszeit vor allem nach der allgemeinen Arbeitskultur im Arbeitsbereich richtet und nicht nach den jeweiligen Vertragsstunden, geraten Mitarbeiter:innen mit Teilzeitverträgen ins Hintertreffen und häufen fast automatisch mehr Überstunden an. Die Ingenieurswissenschaften gehen hier mit gutem Beispiel voran. Hier ist die Quote der Teilzeitverträge geringer und entsprechend sind die wöchentlichen Überstunden nicht ganz so hoch.
Die Arbeitsbelastung zeigt sich zweitens in hohen Ausprägungen so genannter Stressoren. So geben etwa 64 % an, dass sie regelmäßig unter zeitlichem Druck arbeiten. 57 % sagen, dass sie regelmäßig mit der Arbeit im Rückstand sind. Gut die Hälfte gibt an, dass sie regelmäßig frustriert ist aufgrund schlechter Rahmenbedingungen und 40% sehen durch die Arbeit regelmäßig ihr Privatleben beeinträchtigt. Diese Belastungen bergen auch gesundheitliche Risiken. 52 % geben an, dass sie von der Arbeit „oft“, „sehr oft“ oder „immer“, also regelmäßig körperlich oder emotional erschöpft sind. 26,9 % der Befragten reflektieren das und geben selbst an, dass sie ihre Gesundheit als gefährdet ansehen. Man könnte meinen, dass die Postdocs besonders gestresst seien, da sie sich meist nicht in einer sicheren Position befinden und sich deswegen zugleich oftmals in starkem Wettbewerb sehen. Jedoch weist die Gruppe der Professor:innen die höchsten Belastungswerte auf. Darüber hinaus sind es Frauen, die über alle Gruppen hinweg deutlich höhere Stresswerte aufweisen als ihre männlichen Kollegen.
Gleichzeitig zeigt der Vergleich zwischen den Einrichtungen der BUA und den außeruniversitären Einrichtungen im Berliner Forschungsraum, dass an den außeruniversitären Einrichtungen das Stresslevel der Wissenschaftler:innen deutlich niedriger ist. Somit ist es auch Aufgabe des Hochschulmanagements, die Belastungen durch geeignete Maßnahmen zu minimieren. Hier muss auch im Verbund mit der Landeshochschulpolitik analysiert werden, warum die Bedingungen an den Hochschulen so viel ungünstiger sind als an den außeruniversitären Einrichtungen, so dass sie zu deutlich mehr Belastungen bei den hier arbeitenden Wissenschaftler:innen führen. Der Befund korrespondiert damit, dass die Wissenschaftler:innen an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Rahmenbedingungen und vor allem die Verwaltung und sonstige wissenschaftsunterstützende Strukturen weniger beklagen, als dies die Forschenden an den Universitäten tun.
Forschungs- und Arbeitskulturen
Die Forschungskulturen sind geprägt von einem hohen Maß an Wettbewerb in den einzelnen Forschungsfeldern. 49 % der Wissenschaftler:innen berichten von einem starken und weitere 27 % von einem sehr starken Wettbewerb in ihrem Forschungsfeld. Diesem Wettbewerb „nach außen“ steht im eigenen Arbeitsumfeld ein hohes Maß an Kooperation gegenüber bei eher geringem Wettbewerb. Knapp drei Viertel (72 %) aller Befragten berichten, dass die Zusammenarbeit innerhalb ihrer Arbeitsgruppen von einem hohen Maß an Kooperation geprägt ist, dass man sich gegenseitig unterstützt und eine positive Kommunikations- und Fehlerkultur vorherrscht. Gleichzeitig berichten 32 % der Befragten, dass auch ihr engeres Arbeitsumfeld, bzw. die eigene Arbeitsgruppe von starkem oder sogar sehr starkem Wettbewerb geprägt ist.
Die Arbeitskulturen wirken sich auf mehrere andere Aspekte von Forschungskultur aus. So fördert ein kooperatives Umfeld die Innovativität und Produktivität und mindert Gefahren von Diskriminierung und Machtmissbrauch. Gleichzeitig tritt in kooperativen Forschungskulturen deutlich weniger körperliche oder emotionale Erschöpfung auf. Das Arbeiten ist somit auch nachhaltiger. Vor diesem Hintergrund ist es einerseits erfreulich, dass sich mit 72 % der Befragten eine absolute Mehrheit in diesen positiven Forschungskontexten bewegt. Auf der anderen Seite ist es dennoch ein gutes Viertel (28 %) aller Wissenschaftler:innen, das sich in tendenziell unkooperativen und vieler Hinsicht eher problematischen Arbeitskulturen wiederfindet. Hier besteht deutlich Raum für Verbesserungen.
Forschungsqualität
Forschungsqualität ist eines der großen Themen, nicht nur im Wissenschaftsmanagement, sondern auch in wissenschaftspolitischen Debatten und der Community selbst. Der BSS hat sich dem Thema, entgegen vorherrschender Debatten, nicht über Fälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens genähert. Stattdessen wurde geschaut, inwiefern die Forschungsorientierungen der Wissenschaftler:innen ganz grundsätzlich auf Qualität ausgerichtet sind und in welchem Maß qualitätsbezogene Praktiken im Forschungsalltag implementiert sind. Dabei zeigt sich, dass Forschungsqualität einen sehr hohen Stellenwert hat. Die forschungsimmanenten Ziele, „methodische Strenge“ sowie „Originalität von Forschungsergebnissen“, werden von den Befragten als die wichtigsten Ziele angesehen und entsprechend in der Praxis am stärksten priorisiert. Und das, obwohl andere wissenschaftliche Ziele, wie Publikationsoutput und Drittmitteleinwerbungen mit einem stärkeren Erwartungsdruck an die Wissenschaftler:innen herangetragen werden.
Mit Blick auf die Forschungspraktiken zeigt sich ein hohes Maß an implementierten Qualitätssicherungsmaßnahmen. 89 % geben an, ihre Forschungsergebnisse mit anderen zu diskutieren. 87 % geben an, bei Verlagen mit Peer-Review zu publizieren. Ebenfalls recht weit verbreitet ist die interne Qualitätssicherung (Vier-Augen Prinzip) vor der Einreichung von Manuskripten oder Drittmittelanträgen. Im Fall von Manuskripten praktizieren das immerhin 71 % der Forschenden, bei Drittmittelanträgen noch immerhin 55 %. Hier ist somit noch Luft nach oben.
Gegenüber den fächerübergreifenden Qualitätssicherungsmaßnahmen sind solche zu unterscheiden, die nur in einigen Forschungskontexten relevant sind, weil sie von der Art der Wissensproduktion und den eingesetzten Methoden abhängig sind. Praktiken wie Replikationsstudien (13 %), die Veröffentlichung von Null-Results (14 %) oder auch Pre-Registrierung von Forschungsdesigns (14 %) sind nur in einem kleinen Teil der Wissenschaft verbreitet. Wobei Pre-Registrierungen deutlich häufiger in den Sozialwissenschaften (30 %) Anwendung finden, während Replikationsstudien (23 %) und Null-Results-Veröffentlichungen (25 %) in den Lebenswissenschaften verbreiteter sind.
Die fachspezifisch unterschiedliche Verbreitung erklärt sich nur zum Teil damit, dass diese Maßnahmen in einigen Disziplinen besonders vorangetrieben werden, z.B. der Psychologie, der Ökonomie und in der Medizin. Sie sind andererseits auch insofern fachspezifisch und voraussetzungsreich, da sie weder in allen Kontexten einsetzbar noch überall zielführend sind. Wissenschaftspolitik und Management sollten hier Vorsicht walten lassen, diese Maßnahmen als Standardanforderungen auf alle Forschungsfelder zu übertragen.
Qualitätsrisiken entstehen durch eine hohe Arbeitsbelastung. So geben 28,5 % der Befragten an, dass sie „oft“, „sehr oft“ oder sogar „immer“ Qualitätsabstriche bei der Arbeit machen müssen. Dies geht in 80 % der Fälle zu Lasten der Forschung. In 46,6 % der Fälle auch zu Lasten der Qualität in der Lehre. Gleichzeitig beobachten die Wissenschaftler:innen in ihrem Umfeld Praktiken, die auf Qualitätsmängel hindeuten. 18 % beobachten, dass Drittmittelanträge trotz fehlender Qualität eingereicht werden, 20 % beobachten das auch bei der Einreichung von Publikationen. 26 % sehen, dass Forschungsanträge nicht zu Kernforschungsthemen eingereicht werden und gar 47 % nehmen wahr, dass auf Modethemen anstatt auf längerfristige Forschungsagenden gesetzt wird. Diese zwei Praktiken sind nicht per se problematisch, können aber ein Anzeichen für Wettbewerbsdruck und eine Beschleunigung in der Wissenschaft sein, die die Gefahr geminderter Qualität mit sich bringt.
Selektion /Selbstselektion (Wissenschaftlicher Nachwuchs)
Wissenschaftspolitik und Forschungseinrichtungen konzentrieren sich häufig nur auf die Selektion geeigneten Personals und blicken weniger auf die dahinterstehenden Selbstselektionsprozesse. Sie ruhen sich damit faktisch auf der Annahme aus, dass genügend fähige „Nachwuchskräfte“ in die Wissenschaft hineinströmen und es genug „Auswahl“ gibt, um geeignete Kandidat:innen zu selektieren. Sicher, Selektion bleibt wichtig, aber für den so genannten „Wettbewerb um die klügsten Köpfe“ ist es wichtig auch die Selbstselektionen zu analysieren. Hierbei zeigt sich erstens, dass die Mehrheit der Prädocs nicht in der Wissenschaft verbleiben möchte. Zweitens möchte die Mehrheit derjenigen Postdocs, die ein Berufsziel in der Wissenschaft verfolgen, keine Professur, sondern präferiert andere Positionen. Dieser Befund korrespondiert mit einer nur mäßigen Einschätzung der Attraktivität des Berufsbilds „Professur“. Während die Einschätzungen unter den Professor:innen noch überwiegend positiv sind, ist das beim Mittelbau nicht mehr so. Wir interpretieren diese Befunde in direktem Zusammenhang mit der hohen Arbeitsbelastung, den teils entgrenzten Arbeitszeiten und insgesamt dem Stress, der vor allem bei den Professor:innen sichtbar wird. Offensichtlich nimmt ein Großteil des Mittelbaus die Anforderungen und Belastungen im Arbeitsalltag ihrer Vorgesetzten und professoralen Kolleg:innen nicht unbedingt als für sich erstrebenswert wahr.
Die Schwierigkeiten, offene Stellen mit geeigneten Bewerber:innen zu besetzen, zeigen sich bereits in den Fächern, für die die außeruniversitären Arbeitsmärkte sehr gute Alternativen bieten. In den MINT-Fächern beurteilt die Mehrheit der Befragten die Rekrutierungssituation für Postdoc-Stellen und Professuren als eher schlecht oder sehr schlecht.
Anders als erwartet, kann Berlin hier auch nicht mit einem Standortvorteil aufgrund der „Attraktivität der Stadt“ aufwarten. Ein solcher Vorteil gegenüber anderen Exzellenzstandorten hat sich empirisch nicht gezeigt.
Diskriminierung & Machtmissbrauch
Als eine extrem negative Auswirkung schlechter Arbeitskultur sind Vorfälle von Diskriminierung und Machtmissbrauch aufzufassen. Die Ergebnisse des BSS zeigen, dass Diskriminierung ein verbreitetes Phänomen ist und sich nicht nur auf Einzelfälle beschränkt. Fast jede:r vierte Wissenschaftler:in hat selbst Diskriminierung erfahren. So geben 23 % der Wissenschaftler:innen an, schon mindestens einmal im aktuellen Arbeitsumfeld innerhalb der letzten 24 Monate selbst Diskriminierung erlebt zu haben, deutlich mehr (knapp 40 %) geben an, Diskriminierung mindestens einmal beobachtet zu haben. 4 % haben Machtmissbrauch regelmäßig selbst erlebt und knapp 7 % haben es regelmäßig beobachtet.
Damit zeigt sich, dass zwar für den Großteil der Wissenschaftler:innen die Arbeitskontexte diskriminierungs- und machtmissbrauchsfrei sind, dass es jedoch auch eine quantifizierbare Zahl solcher Vorkommnisse gibt, die auf strukturelle Probleme in einigen Arbeitskontexten hindeuten. Fälle von Diskriminierung und Machtmissbrauch kommen gehäuft in Arbeitskontexten vor, die von fehlender Kooperation geprägt sind.
Die sich ergebende Frage lautet: Was wären entscheidende Stellen, an denen Politik und Management Einfluss nehmen können, um die Rahmenbedingungen in der Wissenschaft zu verbessern? Denn wenn die Wissenschaft die „besten Köpfe“ bekommen möchte, wie oft kolportiert, dann muss gewährleistet sein, dass die wissenschaftliche Arbeit möglichst stressfrei, die beruflichen Ziele und Wege attraktiv und die Arbeitskulturen selbstverständlich diskriminierungs- und machtmissbrauchsfrei sind.
Empfehlungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation in der Wissenschaft gekennzeichnet ist durch hochmotivierte Wissenschaftler:innen, die unter eher mäßigen Rahmenbedingungen bestrebt sind, Wissenschaft auf einem hohen Qualitätsniveau durchzuführen. Dabei arbeiten sehr viele bis an ihre Belastungsgrenzen, wodurch Gefahren für die Qualität und Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse entstehen. Deshalb ist es auch Aufgabe des Hochschulmanagements, die Belastungen durch geeignete Maßnahmen und Rahmenbedingungen zu minimieren.
Schwächen des Wissenschaftssystems insgesamt lassen sich kaum durch einzelne Forschungseinrichtungen beheben. Daher stellt sich die Frage, was die Organisationen, die einzelnen Forschungseinrichtungen aber auch die Berlin University Alliance als Verbund im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun können, um die Bedingungen für die Wissenschaftler:innen und damit auch für nachhaltig exzellente Forschung zu verbessern.
Primär sehen wir folgende Handlungsfelder:
- Effektivere Verwaltung und Unterstützungsstrukturen, die an den Bedarfen der Wissenschaftler:innen ausgerichtet sind und ihnen eine echte Entlastung bieten.
- Prävention als Qualitätssicherung: Gestaltung der Organisation als Schutzraum für wissenschaftliches Arbeiten
- Da die Wissenschaftler:innen von sich aus dazu neigen, an ihre Grenzen zu gehen, könnte es sich die Organisation zur Aufgabe machen, hier gegenzusteuern. Sie könnte an einigen Stellen Druck von den Wissenschaftler:innen nehmen. Im Sinn einer Prävention müsste es Ziel sein, Überlastungen früh zu erkennen und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
- Fast noch wichtiger ist es, nicht an anderen Stellen unnötigen Erwartungsdruck und neue Belastungen durch neue Aufgaben aufzubauen.
- Fokus auf kooperative und nachhaltige Forschungs- und Arbeitskulturen anstatt Output-Fixierung
- Da die Wissenschaftler:innen selbst am besten wissen, was in ihren jeweiligen Disziplinen gute Forschung ist, benötigen sie eigentlich keine Zielvorgaben. Hier ist eher Vertrauen angesagt.
- Um Fehlsteuerungen zu vermeiden ist es wichtig, Vertreter:innen verschiedener Disziplinen und Forschungskontexte frühzeitig in geplante Changeprozesse einzubeziehen, um gemeinsam Ziele zu definieren, die dann den verschiedenen Forschungskulturen gerecht werden (Partizipative Governance).
- Um das Risiko von Machtmissbrauch und Diskriminierung zu minimieren und gleichzeitig die bestehende Qualitätsorientierung hochzuhalten, ist es wichtig, im Rahmen des Qualitätsmanagements, nicht nur auf den Output zu schauen, sondern auch auf die Arbeitskulturen, in denen der Output erzeugt wird. Kooperative Arbeitskulturen mit offener Kommunikations- und positiver Fehlerkultur, bei gleichzeitig reduziertem Wettbewerb sind am wenigsten anfällig für diese Risiken. Sie sind somit die nachhaltigeren Arbeitskulturen in der Wissenschaft.
- Wissenschaft als Beruf muss wieder attraktiver werden, sonst gelingt es nicht, den Nachwuchs für diesen Beruf zu begeistern.
- Diese Aufgabe liegt nicht allein bei den einzelnen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, sondern ist eine gesamtpolitische Aufgabe. Jedoch können die einzelnen Organisationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Spielräume nutzen, um die Situation lokal zu verbessern und sich möglicherweise gegenüber anderen Einrichtungen und Forschungsstandorten positiv abzuheben.
- Die Einrichtungen müssen den Mut haben, sich festzulegen, mit wem sie längerfristig zusammenarbeiten möchten. Nach einmaliger intensiver Selektion, Assessment und Evaluation ist es auch eine Frage der Arbeitgeberverantwortung sich festzulegen, mit dem Personal in der Zukunft vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, ohne die Zusammenarbeit an immer weitere Bedingungen zu knüpfen. Hierfür bedarf es geeigneter Konzepte und deren wirksamer Umsetzung, damit diese neue Personalkultur auch nach außen sichtbar wird. Dies kann den Berliner Universitäten bzw. dem gesamten Verbund einen Standortvorteil verschaffen, auch wenn sich die Rekrutierungssituation im Wissenschaftssystem insgesamt weiter verschlechtern sollte.
- Bei der internen Nachwuchsförderung sollte die Kompetenz der Wissenschaftler:innen gestärkt werden, sich kenntnisreich und selbstbewusst für verschiedene Karrierewege innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft entscheiden zu können.
Eine nachhaltige Verbesserung in diesen Handlungsbereichen setzt eine grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen von Lehr- und Forschungsorganisationen voraus.